   |
||||
| Bekanntgabe|home|Nachrichten & Neuigkeiten|Aktuelle Informationen||Link zu Europa|Archiv|Europa-Arena.ORG|Forum|Gästebuch| | ||||
|
0111054 Besucher
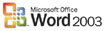 Word 2003 Viewer Falls Sie keine Word Dokumente öffen können, klicken Sie hier um den kostenlosen "Word 2003 Viewer" runter zu laden! Hosting und technische Betreuung von RS Data IT Service |
Zukunft Europas / Frieden ist machbarLiebe europäische Mitbürger, Ihre Mitwirkung eröffnet Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Visionen und Wünsche für die Zukunft Europas zum Ausdruck zu bringen und zugleich etwas über die Visionen Ihrer europäischen Mitbürger zu erfahren. Welche Normen und Werte sollten unsere Lebensweise bestimmen? Welche übergeordneten Ziele sollten für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union festgelegt werden? In welchen Bereichen sollte auf europäischer Ebene zusammengearbeitet werden, in welchen nicht? Wie bewahren wir am besten unsere Liebe und Hingabe für unser Land und entwickeln zugleich gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Identität und einen gemeinsamen Rahmen für gemeinsames Handeln? Die Frage ist: Wie wollen wir Europäer sein, und wie wollen wir es nicht sein? Ganz gleich, ob Sie aus den EU-Mitgliedstaaten oder aus den Beitrittsländern, die bald in der Union zu sein hoffen, oder aus anderen europäischen Ländern kommen: Sie alle sind Teil Europas. Und Sie nehmen nun an einem aufregenden Prozess teil, in dessen Zuge die Grundlage für ein ganzes Europa geschaffen wird - für ein einziges Europa. Ein Europa, das nie mehr geteilt werden darf. Was in einem Teil von Europa geschieht, sollte niemals wieder von den Geschehnissen in einem anderen Teil getrennt sein. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Vision unseres künftigen Europas zu schildern: Es sollte ein Europa sein, in dem die Kriegsangst gebannt ist. Es sollte ein Europa sein, in dem man sicher leben kann. Ein Gemeinwesen auf der Grundlage von Demokratie und der Achtung der Menschenrechte. Ein Ort, an dem alle von zunehmendem Wachstum und Wohlstand profitieren - einschließlich unserer Partnerländer in der dritten Welt. Es sollte auch ein Europa sein, das seine Rolle gegenüber der restlichen Welt wahrnimmt. Ein Europa, das seiner Verantwortung gerecht wird. Ein Europa, das über die notwendigen Mittel verfügt, um erforderlichenfalls Krisen und Konflikte beizulegen. Ein Europa, das bei der Bekämpfung von Armut und Hunger eine führende Rolle übernimmt. Ein Europa mit offenen Märkten, wenn schon nicht mit offenen Grenzen. Darüber hinaus müssen sich die Bürger dessen bewusst sein, dass die EU Teil ihres täglichen Lebens ist. Sie müssen ihre Funktionsweise kennen. Dazu ist ein kontinuierlicher Dialog zwischen Bürgern und Politikern über die laufenden Geschehnisse in der EU erforderlich. Offenheit und Transparenz müssen verbessert werden. Zu wenige Menschen wissen etwas über die Tätigkeit der Union. Dieses fehlende Wissen führt zu Frustration und mangelndem Vertrauen. Mein Wunsch ist es, dass sich Europa auf die wesentlichen Dinge konzentriert, auf Fragen, die die Mitgliedstaaten nicht selbst lösen können. Dies bedeutet weitgehend grenzübergreifende Probleme wie z. B. Außen- und Sicherheitspolitik, Handel, Asylpolitik, internationale Kriminalität, Umwelt und Nahrungsmittelsicherheit. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin für die Politik in den Bereichen Einkommensverteilung und Beibehaltung oder Verbesserung der Sozialleistungen zuständig sein. Dies bedeutet ein Europa, das in einigen Bereichen weniger und in anderen mehr Aufgaben wahrnimmt als heute. Europa sollte zugleich schlanker und schlagkräftiger werden. Das Subsidiaritätsprinzip sollte in höherem Maße angewendet werden, als dies gegenwärtig der Fall ist. Meine lieben jungen, europäischen Mitbürger, Machen wir Europa so kreativ wie Zidane, modern und solide wie Nokia, poetisch und leidenschaftlich wie Shakespeare. Sorgen wir dafür, dass alle, Alt und Jung, Gelehrte und Laien, Europa in derselben Weise verstehen können wie die Märchen von Hans Christian Andersen. Seien wir weise und besonnen wie Plato. Nutzen wir unser gesamtes nationales Erbe zum Vorteil aller. Seien wir national und europäisch zugleich. Ein Auszug aus der Ansprache des Ministers für europäische Angelegenheiten, ( aus der Sicht des EU Politikers Herrn Bertel Haarder) Die Machbarkeit des FriedensAktive Wissenschaftspolitik: Frieden ist machbar... Fast unmerklich ist auch die Grundlagenforschung von dieser Tendenz erfaßt worden: sie soll einigen wenigen Hochtechnologien wie Nukleartechnologie, Datenverarbeitung, Roboterisieruung, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt zugute kommen, während beispielsweise für ökologische oder soziale Probleme nur geringe Förderungsmittel zur Verfügung stehen. Wenn die Forschung auch an den Universitäten immer stärker ökonomischen (oder sogar 'betriebswirtschaftlichen') Steuerungskriterien unterworfen werden soll, so steht dahinter weniger der Wunsch nach dem vernünftigen Umgang mit knappen Mitteln als vielmehr der Wille zur Umverteilung der wissenschaftlichen Ressourcen zugunsten der mächtigsten Wirtschaftsinteressen. Vor diesem Hintergrund von Selektion und Konzentration im Interesse 'der Wirtschaft' kommt es auch zu stärker formalisierten Kontakten zwischen Vertretern der Industrie und der Universitäten, so daß manche von der Herausbildung eines akademisch-industriellen Komplexes sprechen.(1) Immer heftiger wird in diesem Zusammenhang diskutiert, welche Folgen solche Verbindungen zwischen Industrie und Universitäten für die akademische Freiheit haben. So besitzen in den USA schon viele in diesem Forschungszusammenhang tätige Wissenschaftler Aktien der auftraggebenden Firmen. Besonders eklatant ist der Fall des 'Vaters der Wasserstoffbombe' Edward Teller. Er gehörte zu den eifrigsten Beratern Präsident Reagans bei dessen berühmter 'Krieg der Sterne'-Rede vom März 1983; zugleich ist er nomineller Direktor und Besitzer eines Aktienpakets im Werte von rund 800 000 Dollar einer Laser-Firma, die bei diesem Weltaufrüstungsprogramm (SDI) besonders heftig zu profitieren anstand.(2) Besonders bedrohlich ist, daß diese Art der Ökonomisierung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zugunsten weniger Hochtechnologien, auf welche einige wenige nationale und transnationale Großkonzerne setzen, in allen westlichen Industrieländern im wesentlichen parallel verläuft und damit schon unter ihnen einen Konkurrenzdruck oder gar Verdrängungswettbewerb erzeugt, der aus der sogenannten 'dritten industriellen Revolution' eine soziale, politische und ökologische Katastrophe machen kann. Selektive Forschungs-, Technologie- und auch Bildungspolitik dieser Art hat, ob gewollt oder nicht, zur Folge, daß bestimmte Formen der demokratischen, der autonomen, der sozialwissenschaftlich fundierten oder auch nur der traditionell erprobten Wissenschaftsförderung verschwinden und an ihre Stelle die mit Konzernmacht und militärischer Macht verbundenen Regulierungspraktiken einrasten.
Die Universitäten selbst beginnen, sich 'unakademisch', 'protektionistisch' zu verhalten, schreiben amerikanische Beobachter. Da sie Geld brauchen, beginnen sie um Förderungsmittel, gerade auch gegenüber den Konzernen, zu konkurrieren, indem sie die üblichen Wege der akademischen Mitteleinwerbung verlassen und sich über politischen Einfluß möglichst direkt Vorteile zu verschaffen versuchen. So wird deutlich, daß die von der Friedensbewegung formulierten Fragen an die heutige 'Sicherheitspolitik' auch Bedeutung für das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Disziplinen haben. Geschichte und Praxis jeder Wissenschaft sind in einen gesellschaftlichen Bedingungs- und Verwendungszusammenhang eingebettet, über den auch Friedensinteressen und Kriegsinteressen in die fachspezifische Forschung und Lehre transportiert werden. Zahlreiche Fachvertreter beginnen, nicht nur friedensrelevante Informationen und Analysen aus ihrer eigenen Disziplin einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen, sondern zugleich auch die Grundlagen der eigenen Disziplin vor dem Hintergrund der Verantwortung der Wissenschaftler für den Frieden zu reflektieren. Diese durch die Friedensfrage entscheidend vertiefte Reflexion auf den Sinn des eigenen Faches und der eigenen wissenschaftlichen Arbeit scheint der Weg zu sein, auf dem sich langfristig der Beitrag der Wissenschaften zu einer wahrhaften und dauerhaften Friedenssicherung organisieren und zugleich die Verschüttung der aufklärerisch-humanistischen Tradition der Wissenschaften verhindern lassen. Frank Press, Präsident der amerikanischen 'National Academy of Science' hob seinerzeit schon unter dem Schock der Reaganschen Wissenschaftspolitik, die allein der Festigung bestimmter (militär-) technologischer Spitzenpositionen diente, die Notwendigkeit hervor, daß die Wissenschaftlergemeinschaft sich selbst dezidierter zu der Dynamik äußern müsse, die diese Art von Wissenschaftsförderung bestimmt: "Wissenschaft muß sich über kurzfristige Konkurrenzinteressen erheben und vor allem ihren Charakter als eine verbindende Kraft im globalen Maßstab hervorkehren, die alle Kulturen in einer gemeinsamen Erkenntnisanstrengung um der Verbesserung der conditio humana willen umfaßt. Dieser essentiell friedensschaffende Charakter der Wissenschaft kann nur - jenseits aller Finanzspritzen - durch eine gründliche Überprüfung des institutionellen Milieus der Wissenschaften gewährleistet werden. Vor allem gilt dies für die Sicherung der offenen wissenschaftlichen Kommunikation zwischen allen Nationen."(4) Schritt um Schritt beginnt tatsächlich, zum Teil noch in den Grenzen der jeweiligen Disziplinen, eine neue Diskussion über den Sinn wissenschaftlicher Tätigkeit und über das Problem wissenschaftlicher Verantwortung. Ein besonders wichtiges und integres Beispiel für diese Entwicklung ist die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse von mehr als 40 Wissenschaftlern aus dem Kern des naturwissenschaftlichen Establishments gewesen, die sich in der Zeitschrift 'Science' zu den globalen atmosphärischen Wirkungen und langfristigen biologischen Konsequenzen eines Atomkriegs geäußert haben. Hier wird nicht erst nach der Katastrophe, wie seinerzeit nach den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, sondern rechtzeitig und auf eine wissenschaftlich unangreifbare Weise gewarnt.
Über die Machbarkeit des MenschenÜber die Machbarkeit des Menschen In der Ausgabe der Fachzeitschrift Nature vom 2 . September 1999 war ein Aufsatz über eine Maus zu lesen, der ein zusätzlich in Zellen ihres Gehirns eingepflanztes Gen für eine bestimmte Untereinheit des N-Methyl-D-Asparaginsäure-Rezeptors zu einem verbesserten Gedächtnis verhilft. Eine solche Nachricht fordert sofort die Frage heraus, ob denn die Verbesserung einer solchen Eigenschaft auch beim Menschen möglich ist. Man fühlt sich an Aldous Huxley's Roman "Brave New World-Schöne Neue Welt" erinnert, der mit der Beschreibung eines Laboratoriums beginnt, das menschliche eineiige Zwillinge in größerer Zahl zu produzieren vermag. Schon kommt uns das Klonschaf "Dolly" in den Sinn, dessen Produktion am 23. Februar 1997 bekannt wurde und den internationalen Blätterwald gehörig aufgewirbelt hat. Erstmals war damit ein Weg aufgezeigt, auch den Menschen wirksam klonen zu können. In den vergangenen 2.5 Millionen Jahren sind zahlreiche Organismen der Spezies Homo, insgesamt etwa zehn, gekommen und gegangen, von Homo rudolphensis über Homo habilis und Homo erectus bis hin zu Homo neanderthaliensis. Wir, Homo sapiens sapiens, werden vermutlich nicht die letzte sein. Jede dieser Homo-Spezies hat etwa 200.000 Jahre auf diesem Globus verbracht. Den modernen Menschen gibt es seit etwa 130.000 Jahre alt und er hätte damit noch einige Jahrtausende vor sich. Viele Futurologen aber auch zahlreiche angesehene Wissenschafter machen derzeit darauf aufmerksam, dass sich diese Zeitspanne angesichts der neuen Entwicklungen auch verkürzen könnte. Es lohnt sich also darüber nachzudenken, wie nahe wir eigentlich einer gezielten Handhabung und Veränderung des Menschen bereits gekommen sind, und was in den kommenden Jahren auf uns zukommen könnte. Die Beeinflussung der Natur des Menschen setzt Eingriffe in zwei biologische Betriebssysteme voraus, das Gehirn und das Genom. Beide sind in ihrer Funktion nicht wirklich verstanden, was Menschen nicht daran gehindert hat, diese beiden Betriebssysteme zu manipulieren und zu beeinflussen. Paradigmatisch für Eingriffe in das Gehirn stehen beispielsweise die Gehirnwäsche, Indoktrinationen aller Art, stehen die Psychoanalyse, aber auch Arzneimittel wie Prozac oder Ritalin, also stimulierende beziehungsweise antidepressive Arzneimittel. Einige dieser Werkzeuge sind leider immer wieder zum Nachteil des Menschen eingesetzt worden. Wahrscheinlich ist sogar im Namen von Ideologien in diesem Jahrhundert mehr Unheil über die Menschheit und über Menschen gebracht worden, als mit den Mitteln der Genetik. Aber auch die Genetik hat im Laufe der Zeit bereits ihre Schatten auf uns Menschen geworfen, obwohl bis vor kurzem nicht wirklich von einem Verständnis für die Wirkungsweise der Gene die Rede sein konnte. So hat beispielsweise der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. zutiefst daran geglaubt, er brauche am Ende seine "Langen Kerls" nicht mehr in Dänemark einkaufen, sondern könne sie durch Kreuzung hochgewachsener Soldaten mit Frauen entsprechend großer Statur produzieren. Der Versuch ist gescheitert, weil die Generationszeit des Menschen mit ca. 25 Jahren viel zu lange für derartige Experimente ist, und weil die Körpergröße zwar ein genetisch mitbedingtes Merkmal ist, aber ein Merkmal, das durch äußere Faktoren, wie Klima und Ernährung stark beeinflußt werden kann. Eindeutige Erfolge einer Züchtung auf Körpergröße sind daher weder beim Menschen noch bei anderen Lebewesen zu erwarten. Francis Galton, Charles Darwins' ebenso gescheiter wie schillernder Vetter, hatte ähnliche Ideen und war der Meinung, dass das, was züchterisch bei Nutzpflanzen und Nutztieren möglich ist, im Grunde beim Menschen auch realisierbar sein müsste. Er entwickelte das Konzept der Eugenik, in deren Namen in der Folge großer Missbrauch getrieben wurde. Man denke nur an die strengen Einwanderungsgesetze der USA aus den 20er Jahren unseres Jahrhunderts oder an die mörderische Rassengesetzgebung der Nationalsozialisten. Aus heutiger Sicht entbehrt das Konzept der Rasse in unserer Spezies jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die genetischen Unterschiede innerhalb sogenannter Rassen sind in der Regel größer als die unter den verschiedenen Rassen untereinander. Der Weg einer rassistischen Eugenik ist also eindeutig ein Irrweg. All dies und vieles mehr geschah lange vor der biologischen Revolution, die wir heute erleben. Diese begann in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und setzt sich seither mit ungebrochener Geschwindigkeit fort. Es lohnt sich daher zu fragen, was denn eigentlich bislang erreicht wurde und wohin die biotechnologische Reise für uns Menschen als Individuen und als Gattung denn gehen könnte. Der bisher zurückgelegte Weg kann in sieben Punkten zusammengefasst werden. Der Reihe nach: 1: Dank der Gentechnik lassen sich Gene, also Abschnitte unseres Erbguts, die Information für Eiweißbestandteile tragen, heutzutage problemlos isolieren. Ihre Produkte sind längst zu wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten geworden. Allein in Deutschland wurde 1998 mit 51 solcher Produkte ein Umsatz von etwas über einer Milliarde Euro erzielt. Für 2002 wird EU-weit mit einem Umsatz allein von rekombinanten Proteinen, also von Enzymen, Antikörper und Impfstoffen, von 4.15 Milliarden Euro gerechnet. 2: Nicht nur einzelne Gene sondern ganze Genome werden derzeit in ihrem Informationsgehalt verfügbar. Zunächst ging es nur um kleine Genome, wie die von Bakterien und Viren. Im Dezember 1998 konnte aber auch bereits das Genom eines multizellulären Organismus', nämlich das eines Fadenwurms, mit einer Größe von 97 Millionen Buchstaben und 19.099 Genen abgeschlossen werden. Bei den Bakterien standen und stehen die Genome der krankheitserregenden Organismen im Vordergrund, um auf diese Weise Gene zu entdecken, die Anhaltspunkte für neue Therapien liefern könnten. 3: Mit der Verbesserung der Lesetechniken, die an den kleineren Genomen geübt werden, gelang auch die Sequenzierung des menschlichen Genoms mit seinen gut drei Milliarden Buchstaben. Im Februar 2001 wurde erstmals ein vorläufiger Text publiziert und auch der allgemeinen Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht. In der Zwischenzeit bis zum Abschluss des Humangenomprojekts mussten Biologen und Ärzte, die an dieser Information interessiert waren, allerdings nicht nur Däumchen drehen und abwarten. Schon die Analyse der Genome der Modellorganismen erlaubte interessante Schlüsse auf die Biologie und Pathobiologie des Menschen, und zwar wegen der großen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen und uns Menschen. Ein besonders spektakuläres Beispiel ist die Alzheimer'sche Krankheit, die beim Menschen von zwei Genen mitbestimmt wird, nämlich den beiden Presenelin-Genen 1 und 2. Diese Gene finden sich auch im Genom des erwähnten Fadenwurms, der allerdings kein Gedächtnis hat, das er verlieren könnte, sondern nur ein sensorisches Nervensystem. Es erlaubt ihm Wärme und Kälte, aber auch Widerstände aller Art zu erkennen. Der Ausfall der Gene, die bei uns Menschen für die Alzheimer'sche Krankheit veranlagen, führt bei ihm zum Verlust der Fähigkeit, seine Eier zu legen. Diesem Mangel kann durch Wiedereinführen seiner eigenen Presenelin-Gene abgeholfen werden, was nicht weiter überrascht. Überraschend aber ist die Beobachtung, daß der Defekt beim Eierlegen auch durch die menschlichen Varianten der Presenelin-Gene behoben werden kann. Sie sind also auch im Wurmgenom voll funktionstüchtig, obwohl es weit über 200 Millionen Jahre her ist, dass Mensch und Wurm einen gemeinsamen Vorfahren hatten. In dieser Zeit, in der beispielsweise die Dinosaurier gekommen und gegangen sind, hätte viel geschehen können. Die Presenelin-Gene (und viele andere dazu) blieben aber in ihrem Informationsgehalt vollständig erhalten. Offenbar gelingt es der Natur, bestimmte Abschnitte ihres Genoms auch über Jahrmillionen hinweg zu erhalten, wenn diese für die Aufrechterhaltung des Lebens wichtig sind. Als Nebeneffekt dieser Einsicht ist es nun möglich, Anti-Alzheimer Medikamente wirksam am Wurm zu testen, bevor man sie am Menschen ausprobiert. 4: Immer schneller und immer sicherer werden defekte Gene als Auslöser schwerer und schwerster Krankheiten des Menschen identifiziert. Zunächst ging es nur um die gut 4.000 klassischen Erbkrankheiten, deren Ursachen inzwischen fast ausnahmslos aufgeklärt sind. Inzwischen werden aber auch die genetischen Grundlagen von Krankheiten bekannt, die nicht auf dem Ausfall einzelner sondern mehrerer Gene gleichzeitig beruhen. Damit werden auch so komplexe Krankheitsgeschehen wie der Krebs, wie die Herz-Kreislauferkrankungen oder aber auch neurologische Krankheiten, wie die bereits erwähnte Alzheimer'sche Krankheit einer Analyse ihrer Ursachen zugänglich. Schon vor drei Jahren wurde bekannt, daß es in Zellkulturen dreier genetischer Veränderungen bedarf, um eine normale, gesunde menschliche Zelle in eine Krebszelle zu verwandeln. Die Entstehung von Dickdarmkrebs, der häufigsten Todesursache bei Männern, bedarf allerdings der Veränderungen von sechs Genen gleichzeitig in einer Zelle der Darminnenwand. Selbst bei den neurologischen Erkrankungen macht die genetische Analyse nicht halt. So konnte kürzlich durch genetische Intervention eine Maus konstruiert werden, die alle Symptome einer durch Arzneimittel induzierten Schizophrenie aufwies. Beeindruckend sind derzeit die Fortschritte, die auf diesem Felde dank der sogenannten Genchips gemacht werden. Es handelt sich um daumengroße Glasblättchen, auf denen Tausende von Genen in Form ihrer DNA fixiert sind. Mit echten Microprozessoren haben diese Genchips allerdings nur den Namen gemeinsam, denn sie sind sehr viel einfacher herzstellen als diese. Dennoch führen sie im Ergebnis zu einem eben so großen Beschleunigungsprozess, wie die Mikroprozessoren. Indem nämlich auf ihnen das Äquivalent eines ganzen Genoms, also alle Gene eines Organismus repräsentiert sind, erlauben sie den gleichzeitigen Vergleich aller Genaktivitäten einer Zelle, also beispielsweise zwischen einer Krebszelle und einer gesunden Zellen. Ein solcher Vergleich hat früher Jahre gedauert. So besteht für mich kein Zweifel daran, daß in absehbarer Zeit auch die genetischen Ursachen der multifaktoriell bedingten Volkskrankheiten, darunter auch Asthma und Arthritis, bekannt sein werden. 5: Gene können in Zellen übertragen werden, wenn auch derzeit nur mit geringer Effizienz. Wir kennen zwei Strategien der Genübertragung, die Übertragung in Körperzellen und die Übertragung in Keimzellen. Der Unterschied ist der, daß bei der Therapie von Keimzellen die genetische Veränderung nur bei den Nachkommen wirksam wird, also auch in zukünftigen Generationen. Bei Versuchstieren, wie Würmern, Fliegen und Mäusen, ist der Eingriff in die Keimbahn eine gängige Methode geworden, um die Rolle einzelner Gene in der Entwicklung von Organismen zu studieren, oder aber auch um Modelle für menschliche Krankheiten zu erzeugen. Die Ausbeuten dieser Versuche sind trotz jahrelanger Optimierungsversuche schlecht und weit davon entfernt, was man von einer genetischen "Schluckimpfung" beim Menschen als Voraussetzung verlangen würde. 6: Vor wenigen Jahren wurde es erstmals möglich, erbgleiche Organismen auch aus Zellen erwachsener Organismen herzustellen. Klone sind an sich keine Seltenheit in der Natur. Die schwierige Examensfrage, ob es beim Menschen ungeschlechtliche Vererbung gibt, muß mit einem klaren Ja beantwortet werden. Alles andere würden sich die ca. 6 Millionen eineiiger Zwillinge auf dieser Welt verbieten lassen. Neu an der erstmals mit der Erzeugung des Schafs "Dolly" entwickelten Technologie war die Transplantation eines Zellkerns aus einer ausdifferenzierten Zelle in eine Embryozelle, die von ihrem eigenen Zellkern befreit war. In dieser Umgebung ließ sich der aus der erwachsenen Zelle stammende Zellkern aus seinem hochspezialisierten Zustand in einen Zustand reprogrammieren, der die Bildung eines ganzen Organismus erlaubte. Dies war eine wissenschaftliche Sensation, weil wir alle bis dahin der Meinung waren, die Differenzierung von Zellen verliefe immer nur in eine Richtung, vom Embryo zum erwachsenen Zelltyp, und niemals umgekehrt. Mit "Dolly" wurde dies anders. Mit "Dolly" wurde es auch möglich, Klone zu einem Zeitpunkt herzustellen, an dem, anders als auf der Ebene des Embryos, die zu vervielfältigenden Eigenschaften bereits bekannt sind. Die Versuche zum Klonen per Kerntransplantation sind inzwischen bei Mäusen, Rindern und vielen anderen Organismen wiederholt worden, so daß an dieser Technologie keine Zweifel mehr bestehen. Obwohl mehrfach angekündigt, beispielsweise durch den Italiener Severino Antinori oder durch die Raelisten, ist sie bislang beim Menschen nicht eingesetzt worden, auch wenn ein solcher Einsatz immer wieder die Gemüter erregt. Hintergrund dieser Besorgnis ist wohl nicht der Klon an sich, der uns ja als eineiiger Zwilling immer wieder entgegentritt, ohne daß dies besorgniserregend ist, sondern die Tatsache, daß die menschlichen Klone à la Dolly nicht mit dem Ziel ihrer selbst, sondern durch Bestimmung eines Dritten hergestellt würden. Es ist dieses gezielte Aussetzen des genetischen Schüttelvertrages, der den Einsatz dieses Verfahrens beim Menschen als verwerflich erscheinen läßt. 7: In den vergangenen drei Jahren ist es erstmals möglich geworden, embryonale Stammzellen des Menschen herzustellen. Embryonale Stammzellen entstehen immer dann, wenn Embryos, also befruchtete Eizellen, außerhalb ihres normalen Habitats gehalten werden. Solche Zellen, deren Herstellung beim Menschen bis vor wenigen Jahren nicht möglich war, haben die Eigenschaft, sich in alle ca. 300 Zelltypen ausdifferenzieren zu können, aus denen ein Säugerorganismus besteht, dies aber nicht alleine, sondern immer nur im Kontext eines wachsenden Embryos. Sie sind daher nicht toti- sondern nur pluripotent. Sie können also nicht direkt zur Herstellung intakter, erbgleicher Organismus, sogenannter Klone verwendet werden, sondern nur über den Umweg aufwendiger Rückkreuzungen. Statt dessen ist daran gedacht, diese Zellen, insbesondere in Kombination mit dem "Dolly"-Verfahren, nicht zum Klonen ganzer Organismen, sondern dem sogenannten therapeutischen Klonen einzusetzen. Die Zellen würden zu diesem Zweck mit einem Cocktail von spezifischen Wachstumsfaktoren in bestimmte Zelltypen und Organe umgewandelt, die dann in den Organismus, aus dem der Zellkern stammte, zurück verpflanzt zu werden. Bislang allerdings sind diese Cocktails nicht in Sicht, und bislang ist nicht klar, ob die Herstellung von Organen aus Embryozellen vielleicht nur im Kontext eines wachsenden Organismus möglich ist. Dennoch wird dieser Technologie ein großes Anwendungspotential zugeschrieben, und zwar insbesondere dann, wenn es gelänge, nicht den Umweg über embryonale Stammzellen gehen zu müssen, sondern über sogenannte adulte (erwachsene) Stammzellen. Schon lange war bekannt, daß das blutbildende System eine eigene Klasse von Stammzellen besitzt, die nicht die breite Potenz der embryonalen Stammzellen aufweisen, sondern als Vorläufer allein für die Zellen des Immunsystems dienen. Solche Zellen spielen heute bereits eine große Rolle in der Knochenmarkstransplantation, die als Folge von schweren Blutkrebserkrankungen durchgeführt werden. Sie werden nach der Abtötung des krebsverseuchten Knochenmarks den Patienten wieder zurückgegeben, und dienen als Quelle des Aufbaus eines neuen Immunsystem. Seit einiger Zeit wird bekannt, daß adulte Stammzellen auch in vielen anderen Organen zu finden, selbst im Gehirn. Noch bis vor drei Jahren habe ich meinen Studenten erzählt, daß wir bezüglich unseres Gehirns aus der Substanz leben, daß sich unsere Gehirnzellen niemals teilen und erneuern. Nach der kürzlich erfolgten Entdeckung von Stammzellen des Gehirns ist dies nun nicht mehr wahr. Man kann sich durchaus vorstellen, daß solche Stammzellen in einer wenn auch weit entfernten Zukunft einmal zur Behandlung etwa der Parkinson'schen Krankheit eingesetzt werden. Es gibt inzwischen Stammzellen für die Leber, für die Inselzellen der Bauspeicheldrüse und für viele andere Organe mehr. Sie könnten in der Zukunft große therapeutische Bedeutung gewinnen. So stehen uns also heute eine Vielzahl von Technologien zur Verfügung, die in Versuchstieren die Erzeugung gezielter genetischer Veränderungen erlauben. Sofort stellt sich daher die Frage, ob diese Techniken auch auf den Menschen angewandt werden könnten. Rein technisch gesehen muß sie mit einem klaren Ja beantwortet werden. Wenig oder nichts spricht dafür, daß die Biologie des Menschen auf dieser Ebene der Erzeugung von Körper- oder Keimzellen grundsätzlich anders abläuft, als beispielsweise im Falle der Maus. Wenn dem so ist, dann wird der Einsatz der biogenetischen Künste (Hans Jonas) von zweierlei abhängen, von den Zielen, die über die Handhabung des menschlichen Genoms erreicht werden sollen und von den normativen Grenzen, die dem Erreichen dieser Ziele gegebenenfalls entgegenstehen. Beantworten wir diese Fragen der Reihe nach. Wie alle anderen Lebewesen sind wir Sklaven unseres Genoms. Die Abhängigkeit von unseren Genen ist absolut. Man sieht es schon daran, daß der Ausfall auch nur einzelner Gene zu schwersten Komplikationen führen, wenn nicht sogar mit dem Leben unvereinbar sein kann, wie es nicht zuletzt die monogenen Erbkrankheiten demonstrieren. Auch viele unserer äußeren Merkmale, wie die Hautfarbe, die Form des Gesichts, die Farbe der Augen bis hin zur allgemeinen Körperhaltung sind allein durch die Aktivität der Gene bestimmt. Dies ist der Grund, warum erbgleiche Organismen, auch Klone genannt, vom Äußeren her praktischen identisch sind. Auf dieser Ebene der sogenannten einfachen Merkmale schlägt das Genom voll auf den Phänotyp, also auf das äußere Aussehen durch. Entsprechend eindeutig und übersichtlich erweisen sich auch die Erbgänge. Anders bei vielen der weit verbreiteten Volkskrankheiten, darunter Krebs, Herz-Kreislauferkankungen und Alzheimer, die ebenfalls eine genetische Grundlage besitzen. Diese basiert aber nicht, wie bei den monogenen Erbkrankheiten, auf dem Ausfall eines einzigen Gens, sondern dem Ausfall von mehreren Genen gleichzeitig. Bei Dickdarmkrebs beispielsweise müssen sechs Gene auf einmal in einer Zelle der Darminnenwand ausfallen, damit diese Zelle zu einer Krebszelle wird. Bei diesen Krankheiten gehorchen die Erbgänge deshalb nicht mehr den Mendel'schen Gesetzen, weil sich im genetischen Schüttelprozess sechs Gene eben unübersichtlicher verhalten als nur ein Gen. Bei den kognitiven Merkmalen, wie dem Bewußtsein, der Musikalität oder der Intelligenz, die Merkmalen also, die uns erst wirklich zu Menschen machen, kommt zu dem genetischen das kulturelle Erbe hinzu. Hier geht es um ein Wechselspiel zwischen Genom und Umwelt, das im einzelnen kaum verstanden ist. Hinweise auf die Existenz solcher Wechselwirkungen sind allerdings nicht gering. So lassen sich die Erbgänge der Musikalität, wenn überhaupt, nur sehr undeutlich erkennen. Die Erbgänge der Musikalität beispielsweise sind, wenn überhaupt erkennbar, nur sehr undeutlich. Mozarts Söhne sollen zwar musikalisch begabt gewesen sein, waren aber von der Genialität ihres Vaters weit entfernt. In der Wiener Familie Strauß hat die musikalische Begabung zwar über zwei oder drei Generationen hinweg gereicht, um dann aber doch im Nebel des genetischen Schüttelprozesses zu verschwinden. Die Altersunterschiede zum Zeitpunkt des Todes sind bei zweieiigen Zwillingen doppelt so groß, wie bei eineiigen Zwillingen, was für einen wesentlichen Beitrag des Genoms bei der Lebenserwartung spricht. Andererseits ist die Ähnlichkeit im Intelligenzquotient zwischen eineiigen Zwillingen, die getrennt aufwachsen, geringer, als zwischen eineiigen Zwillingen, die gemeinsam aufwachsen. Dies wiederum spricht dafür, daß das identische Genom hier nur in begrenztem Maße durchschlägt, sondern daß es vielmehr auf die Unterschiede im Milieu ankommt, in dem die Zwillingspaare aufwachsen. Die Analyse dieser Phänomene ist schwierig, weil einmal die Zahl derartiger Zwillinge vergleichsweise gering ist und entsprechende Analysen statistisch kaum relevant sind, und weil auch die Tests für komplexe kognitive Merkmale nur unvollkommen sind. Kürzlich wurde, wie eingangs erwähnt, eine Maus beschrieben, die durch Einbau eines einzelnen Gens in ihr Genom in bestimmten für Mäuse geeigneten Tests durchaus besser abschnitt als ihre unbehandelten Brüder bzw. Schwester. Die Presse sprach von einer "besseren", von einer "smarten" Maus und extrapolierte sofort auf den Menschen. Es ist jedoch keine Frage, daß die für das Verhalten von Mäusen entwickelten Testsysteme nicht direkt auf bewußtseinsgesteuerte Eigenschaften des Menschen anwendbar sind. Wir müssen zwischen genomgesteuerten (triebhaften) und bewußtseinsgesteuerten Verhaltensprozessen unterscheiden, wobei derzeit offenbleiben muß, wo die jeweiligen Anteile des Genoms enden und die eines Einflusses des soziokulturellen Umfelds genau beginnen bzw. wie sie gegeneinander abgegrenzt sind. Daß aber der reinen Biologie bei den Leistungen unseres Gehirns durchaus Grenzen gesetzt, und daß deshalb gerade diese Leistungen daher durch genetische Manipulation ganz grundsätzlich nicht beeinflußt werden können, daran besteht gerade im Zeitalter der Genomforschung kein Zweifel. Auch wenn also der Machbarkeit des Menschen einige grundlegende Grenzen gesetzt sind, bleibt doch kein Zweifel daran, daß die biotechnologische Revolution in ihren Anwendungen auf den Menschen unser Leben entscheidend verändern wird. Weil so lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen nunmehr auf ihre Ursachen zurückgeführt werden können, wird nicht nur ihre Behandlung auf völlig neue Grundlagen gestellt werden können, sondern erstmals auch eine sinnvolle Prävention möglich werden. Zwar haben wir auch vorher schon gewußt, daß Tabakrauch einen bedeutenden Risikofaktor für Lungenkrebs darstellt, aber eben nur auf rein statistischer Basis. Heute ist es jedoch möglich, im Einzelfall die Veranlagung für diese und andere Krebserkrankungen zu untersuchen, und, gegebenenfalls, ihren Verlauf zu verfolgen. Beides zusammen, Diagnose und Therapie, wird Auswirkungen auf unsere Lebenserwartung und unsere Lebensqualität haben. Da unsere Lebensspanne bei ca. 110-115 Jahren fixiert ist, werden die Menschen in einem immer kleiner werdenden Zeitabschnitt sterben. Sobald die Lebenserwartung die Lebensspanne erreicht hat, sterben wir alle eines natürlichen Todes. Leonard Hayflick, einer der großen Altersforscher der USA, nennt diesen Effekt das "rechtwinklige Leben", also ein Leben mit konstant hoher Lebensqualität, die erst ganz kurz vor dem Tode, aber dann um so rapider, abnimmt. Von diesem Zustand sind wir weit entfernt. Dennoch wird damit gerechnet, daß beispielsweise in den USA die Zahl der über 85-jährigen von 4 Millionen im Jahre 2000 auf 31 Millionen im Jahre 2050 zunehmen wird. Man kann nur ahnen, welch schwerwiegende Folgen diese Entwicklung auf unser Arbeitsleben, die Finanzierung des Alters und die Kosten des Gesundheitswesen haben wird. Dafür, daß diese Zeitspanne durchaus überschaubar ist, in dem dieser Zeitpunkt von über zwei Drittel der derzeit lebenden Menschen auch erreicht werden wird, geschieht auf der politischen Ebene wenig, allzu wenig, was dieser Fragen auch nur im Ansatz gerecht werden könnte. Das Problem könnte sich noch potenzieren, wenn die Kenntnisse über unser Erbgut uns in den Stand versetzten, dereinst auch unsere Lebensspanne, also das maximal von Menschen erreichbare Alter, signifikant hinauszuschieben. Daß die Lebensspanne genetisch fixiert ist, daran bestehen kaum Zweifel. Warum wäre sonst die Lebensspanne einerseits für jede Spezies so wohl definiert und andererseits von Spezies zu Spezis so unterschiedlich, wie wir es beobachten? Obwohl alle Lebewesen letztlich die gleiche chemische Zusammensetzung haben, und sich damit Verschleiß und Beanspruchung der Organismen auf dieser Basis kaum unterscheiden sollten, lebt eine Eintagsfliege einen Tag, eine Hausfliege 15 Tage, eine Ameise 15 Jahre, ein asiatischer Elefant 80 Jahre und der Mensch eben 110 bis 115 Jahre. Langlebigkeit vererbt sich sowohl bei Tieren als auch beim Menschen. Bei Mäusen gibt es ingezüchtete Stämme, die nur ein Jahr alt werden, und andere, die es bis zu fünf Jahren schaffen. Von unserer Spezies wissen wir, daß über 60% der Hundertjährigen Eltern haben, die ebenso alte geworden sind, eine altbekannt Erfahrung, die Lebensversicherer schon immer in ihre Prämienberechnung einbezogen haben. Trotz dieser Hinweise auf die genetischen Grundlagen unserer Lebensspanne ist klar, daß es sich um ein komplexes Merkmal handelt, dessen genaue genetischen Hintergründe bislang jedenfalls auch nicht ansatzweise bekannt sind. Es ist daher müßig daran zu glauben, daran würde sich mittelfristig etwas ändern. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob wir denn, selbst wenn wir es könnten, eine solche Verlängerung denn auch tatsächlich wollten. Damit wird die Problematik des Menschenbilds aufgeworfen, das hinter einer gezielten Steuerung unserer eigenen Natur stehen soll. Gemessen an einer Ethik, die, wie die international durchaus vergleichbaren Reaktionen auf diese Herausforderungen der Genomtechniken zeigen, nicht einmal unbedingt eine christliche sein muß, solange sie auf den Menschenrechten basiert, sind dem Einsatz vieler moderner Techniken eindeutige normative Grenzen gesetzt. Man denke nur an die technischen Mittel, die bei den Klonierungsversuchen zum Einsatz kamen, als es um die Erzeugung des Schafs "Dolly" ging. In diesem Fall mußten 277 chimäre Embryos hergestellt werden, von denen knapp 30 zu Föten führten, von denen aber nur ein einziger ausgetragen werden konnte. Es ist kaum vorstellbar, derartig risiko- und verlustreiche Versuche auf den Menschen übertragen zu wollen. Auch die moderne, auf den Methoden der Analyse des Erbguts basierenden diagnostischen Möglichkeiten können neben ihren vielen wertvollen Aussagen über dessen Identität und Zustand durchaus schwerwiegende ethisch-moralische Bedenken aufwerfen. Angesichts der schnellen Fortschritte der Genomanalyse können heute Krankheiten diagnostiziert werden, die nicht heilbar sind. Bei den durch den Ausfall mehrerer Gene gleichzeitig bedingten Krankheiten lassen sich defekte Gene identifizieren, die die statistische Wahrscheinlichkeit für ihr Auftreten nur erhöhen, aber nicht unmittelbar zum Ausbruch der Krankheit führen. Wegen des genetischen Generationenvertrags muß die Analyse einer genetisch bedingten Krankheit unmittelbar auch verwandte Personen belasten, die dies. vielleicht gar nicht wissen wollen. Umgekehrt sind an den Ergebnissen der Genomanalyse Lebens- und Krankenversicherer interessiert sein. In all diesen Fällen werden das Grundrecht auf Menschenwürde, das Recht auf Nichtwissen aber auch die Vertraulichkeit des Arzt/Patientenverhältnisses auf die Probe gestellt. Die letzte Frage, die ich in diesem Zusammenhang aufwerfen möchte, ist die, wie wir mit solchen Grenzsituationen in dieser Gesellschaft tatsächlich umgehen. Eine entsprechende Frage würde ich selbst mit einen Hinweis auf Charles Dickens in seinen "Erzählungen aus zwei Städten" beantworten: "Es war die beste und die schlechteste aller Zeiten". Warum das? Es war die beste aller Zeiten, weil es in der Folge unserer Empfehlungen zur Stammzellforschung zu einer ausgedehnten gesellschaftlichen Debatte kam, die insbesondere im Parlament mit beachtlichem Sachverstand und auch der nötigen Sensibilität für das Thema geführt wurde. Es war nicht nötig, mit diesen Fragen an die Öffentlichkeit zu gehen, denn der Import von embryonalen Stammzellen war nicht verboten. Wir haben es dennoch getan, weil wir der Meinung waren, dass zwar in diesem Lande Wissenschaft und Kunst grundgesetzlich frei sind, dass aber dennoch die Wissenschaft die Pflicht hat, in solchen Grundsatzfragen die Meinung der Gesellschaft zu suchen, und ihr in Form des Deutschen Bundestags als Souverän die Entscheidung zu überlassen. Was ich weniger erfreulich finde, sind einige Facetten des letztlich erzielten Kompromisses zum Stammzellimportgesetz, wie es am Ende zustande gekommen ist. Zwei Dinge sind hier zu kritisieren. Einmal die Stichtagsregelung, die nur solche Zellen zu importieren erlaubt, die vor dem 1. Januar dieses Jahres hergestellt worden sind. Hier wurde ein Gedanke des amerikanischen Präsidenten nachempfunden, ohne sich klar zu machen, dass es auch die Pflicht der Wissenschaft ist, immer die möglichst besten Rahmenbedingungen für die Forschung zu suchen. Wir können nur hoffen, dass wenigstens einige wenige der bis zu diesem Stichtag hergestellten Zellen für die geplanten Versuche geeignet sind. Der zweite, mindestens so schwerwiegende Kritikpunkt ist für uns die Strafbewehrung gerade dieses Gesetzes. Natürlich ist es das gute Recht des Deutschen Bundestages, solche Strafparagraphen einzuführen. Im konkreten Fall geht es jedoch nicht um das Inland, sondern konkret um die Auslandsbeziehungen der Wissenschaft. Das Importgesetz betrifft nämlich per definitionem die Beziehungen zu ausländischen Wissenschaftlern und Einrichtungen, von denen die gewünschten Zellen zu beziehen sind. Da mit diesen Wissenschaftlern in irgendeiner Weise Kontakt aufgenommen werden muss, ist offen, inwieweit sich deutsche Wissenschaftler samt ihren ausländischen Kollegen allein schon hierdurch strafbar machen. Ich hatte immer gehofft, dass die aus den Diskussionen in der deutschen Öffentlichkeit abgeleiteten gesetzlichen Regeln Vorbild hätten sein können für andere Länder oder gar entsprechende europäische Regelungen. Denn in der Sache war der Gedanke, allein mit überzähligen Embryonen zu arbeiten, statt sie zu Forschungszwecken herzustellen, durchaus ein kompromissfähigen Vorschlag, der auch das gesamte Klonen, ob nun therapeutisch oder reproduktiv, ausschloss. Die Stichtagsregelung und vor allem die Strafbewehrung haben leider dazu geführt, dass das Ausland diese unsere Regelungen wenig ernst nimmt, sie zumindest nicht zum Vorbild für ihre eigenen Gesetze macht. Dass dies auch unsere Stellung in Sachen internationaler Regelungen zu einem Verbot des Klonen nicht gerade stärkt, war gerade am vergangenen Wochenende wieder einmal zu sehen, als der Einspruch der USA und einiger anderer Länder die Angelegenheit zunächst einmal bis September 2003 auf Eis gelegt hat. Mit Maximalforderungen ist auf diesem Parkett wenig zu erreichen. Mit meinen Ausführungen habe ich sie an die Grenzen des Wissens im Umfeld der modernen Genetik geführt. Diese Grenzen wurden in den letzten Jahren weiter vorgeschoben, als wir uns dies noch vor kurzer Zeit vorstellen konnten. "Denken heisst Überschreiten", so hat Ernst Bloch in seinem Vorwort zu seinem "Prinzip Hoffnung" seine Überzeugung über die Veränderbarkeit der Welt formuliert. Diese Veränderbarkeit wird und darf ihrer Reichweite nicht grenzenlos sein können. Immerhin ist hoffentlich klar geworden, dass die Biologie letzten Endes doch nicht planbar ist und dass der Machbarkeit des Menschen Grenzen gesetzt sind, die wir mit biologischen Methoden niemals werden überschreiten können. Dazu wird im Psalm 8 die Frage gestellt: "Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die Du bereitet hast: Was ist der Mensch, daß Du seiner gedenkst?". Die Biologie alleine wird diese Frage wohl niemals beantworten können. * Der Autor lehrt Biochemie an der Ludwig-Maximilians Universität München und ist derzeit auch Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Kontakt zu Otto Pirzl MAS |
|||
| Impressum | Haftungsausschluss | Admin | Copyright © 2005 Otto Pirzl - Alle Rechte vorbehalten. | ||||